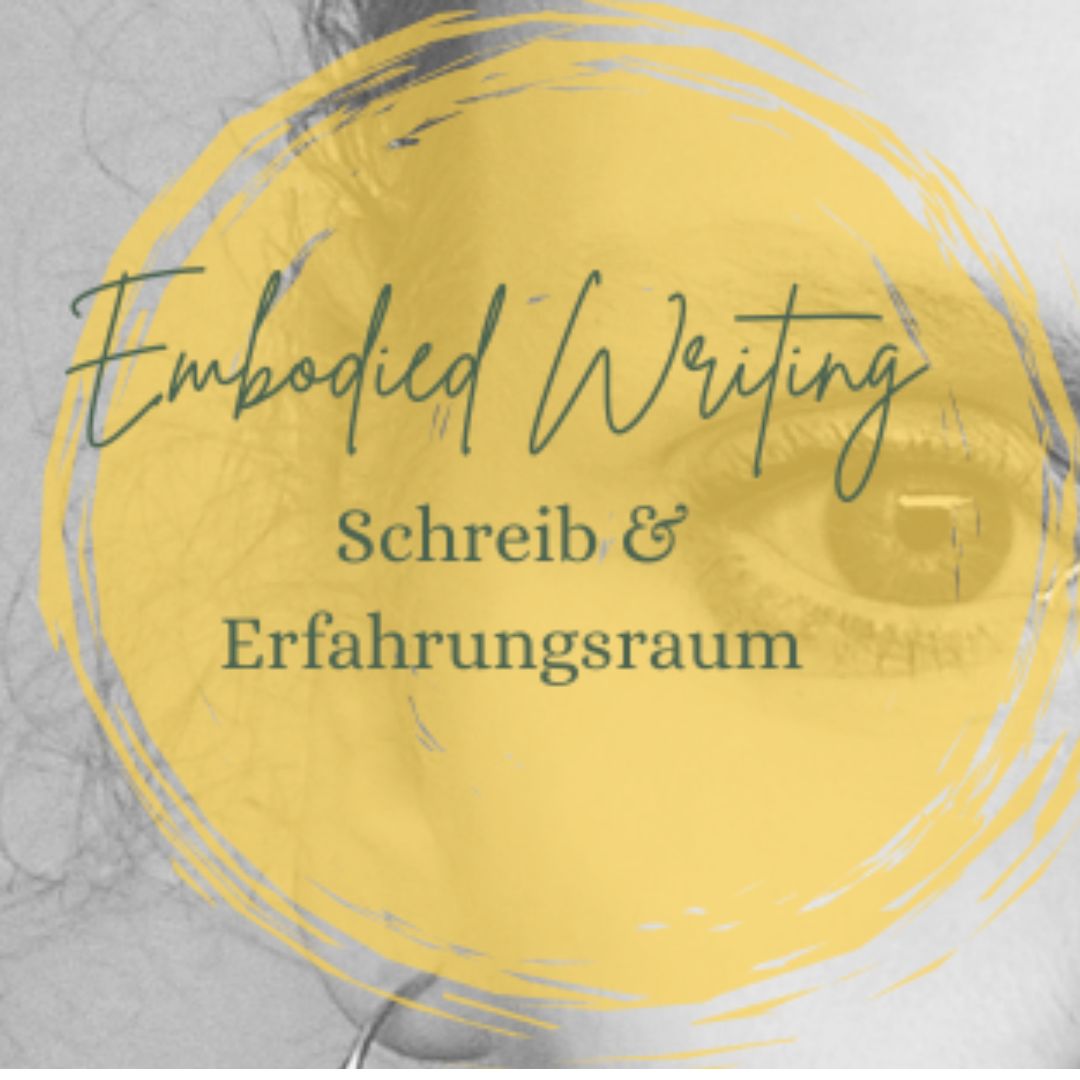Jetzt bin ich befangen. Ernüchtert, im wahrsten Sinn des Wortes. Ein typischer Morgen danach. Er sitzt mir gegenüber und sieht einfach gut aus. Solide gut, was ich nach dieser Nacht bemerkenswert finde. Schon eine Weile sitzen wir uns gegenüber und trinken schweigsam Kaffee. Mich ärgert meine eigene Schüchternheit, ich senke sogar den Blick und frage mich im selben Moment wie alt ich nochmal bin? Ich sehe, dass seine Lippen sich bewegen.
„Wie bitte?“
„Hast du auch solche Kopfschmerzen?“, fragt er höflich.
Er ist mir auch jetzt sympathisch. Einigermaßen. Obwohl die Frage blöd ist, denn ich sehe sicher aus, als hätte ich Kopfschmerzen. Ich streiche durch meine Haare. Mein Magen knurrt außerdem laut und ich sehe einen Hamburger mit Fritten vor meinem geistigen Auge. Auf meinem Tisch steht allerdings nur diese edle Schale mit basischem Müsli und Hafermilch. Statt einer Antwort zucke ich mit den Schultern, unfähig auch nur einen sinnvollen Satz zu bilden. Das kann nur bedeuten, dass ich zuviel Dope geraucht habe. Seit Jahren vertrage ich das nicht mehr und rauche trotzdem immer wieder.
„So schlimm?“ Er sieht mich anteilnahmsvoll an.
Etwas in seinem Tonfall geht mir augenblicklich auf die Nerven. Erinnerungsfetzen der letzten Nacht sind mir vor Augen. Ich stöhne entsetzt auf, was ihn augenscheinlich irritiert.
„Alles okay?“, hakt er nach.
„Äh, ja, Kopfschmerzen. Mir ist auch schlecht.“ Ich ziehe meinen grauen Morgenmantel fester um mich und wippe mit meinem übergeschlagenen Fuß. Während ich also so da sitze und wippe, wird mir verlangsamt klar, dass sich an der Information „Mir ist auch schlecht“, die Möglichkeit eröffnet auf unbestimmte Zeit im Bad zu verschwinden. „Ich muss dann ins Bad und dann zur Arbeit“, sage ich lahm und rutsche vom Hocker.
„Am Sonntag?“
„Äh ja – “ Ich hebe die Hand zum Gruß. „Also dann!“ Ich lasse ihn sitzen. Das Beste in der Situation.
Sonntag? Ist heute Sonntag? Im Bad versuche ich meine Bewegungen zu koordinieren und komme mir wirklich langsam vor, was daran liegt, dass ich langsam bin. Ein zaghaftes Klopfen an der Badezimmertür und ein leises „Ciao“ lässt mich erleichtert aufatmen.
Ich jogge meine Runde um den Block und laufe spontan noch in den Park. Es ist immer so. Eigentlich fühle ich mich schlapp, eigentlich will ich nur eine kleine Runde, dann aber gehts mir immer besser und ich bin, wenn ich zeitlich kann, ein paar Stunden unterwegs. Nirgendwo besser kann ich Klarheit in meinen wirren Kopf bringen. Heute dauert es lang. Wenigstens habe ich das Gefühl mich wieder normal schnell zu bewegen und nicht in Zeitlupe, wie vorhin im Bad.
Ich bin jetzt 38. Mama fragt mich regelmässig, wann ich endlich erwachsen werde, heirate und Kinder kriege und aufhöre zu pubertieren. Ist das nicht unverschämt von ihr?
Mechanisch pumpe ich an der nächsten Bank Liegestütze, zwei Durchgänge und verzichte auf die Sit-ups, da die Bank total nass ist. Das sind auch meine Füße, aber solange ich laufe, ist mir das egal.
Nach eineinhalb Stunden biege ich in die Straße ein und Oma Schmitt kommt gerade aus dem Hinterhof. Auf dem Kopf die obligatorische Regenhaube, die aussieht, wie ein Hexenkopftuch aus Plastik. Und ihrem Nachziehwagen, neuestes Modell plus Regenschirm, ohne den sie nie das Haus verlässt.
„Morgen!“, rufe ich ihr gutgelaunt entgegen.
„Ham Sie immer noch kein´ Schirm?“ Sie hält ihren schräg nach oben und betrachtet mich kritisch von unten.
„Frau Schmitt, ich hab `ne Kapuze – beim Joggen würd mich ein Schirm stören.“ Ich rolle mit den Augen, aber das sieht sie nicht.
„Ihr jungen Leute – „
Ich bin schon an ihr vorbei, drücke die schwere Haustür auf und laufe die Treppe hoch. Blitzlichtartig kommen mir Bilder der letzten Nacht in den Kopf und mir wird noch heißer, als mir sowieso schon vom Laufen ist. Vor meiner Tür stütze ich mich gegen die Wand und verschnaufe.
Nein, anrufen werde ich ihn nicht. Muss nicht sein. Ich schließe auf und quäle mich aus den nassen Klamotten.
Ich genehmige mir ein Bad. Als ich schon in der Badewanne liege und dem einlaufenden Wasser zuhöre, fällt mir wieder ein, dass ich dem Vermieter Bescheid sagen muss. Das Fenster ist undicht, es zieht. Zum einen heize ich im Winter aus dem Fenster, zum anderen ist es echt unangenehm. Die Wohnung ist Altbau und nur partiell rennoviert. Das hat zwar Charme, aber nur im Sommer. Mit Schrecken denke ich an das vergangene Frühjahr, als ich mit einer Grippe und hohem Fieber zwei Wochen in dieser nur mäßig zu beheizenden Wohnung festsaß.
Mit einem Aufseufzen sinke ich nochmal ins warme Wasser und werde müde. Was steht an an diesem Sonntag? Was mache ich aus meiner freien Zeit? Was mache ich überhaupt mit meiner Zeit? Immerhin bin ich schon gejoggt. Ich beschließe, zu waschen und aufzuräumen. Und endlich einmal wieder alles durchzuputzen. Dann könnte jemand, der die Gene meiner Mutter in sich trägt, heute Abend zufrieden sein. Damit, etwas geleistet zu haben. Sonntag hin oder her.
Ich quäle mich also aus der Badewanne, wickle mich in mein großes, flauschiges Handtuch und stehe eine Weile vor dem Spiegel. Fröstle, starre mich an. Mit langsamen Bewegungen wische ich den Spiegel sauber, nur um mich über meine Augenringe zu ärgern. Wieder komme ich mir langsam vor. Frischeingecremt mit meiner neuen, teuren Bodylotion, trete ich in den kalten Flur.
Fido ist, wie meistens, nicht daheim. Fido ist mein Mitbewohner. Ohne ihn könnte ich die Miete kaum bestreiten oder müsste auf einigen Luxuskram verzichten. Und das geht gar nicht, jetzt, so nahe der vierzig. Er ist Künstler und viel auf Reisen wegen seiner Ausstellungen. Seine Bilder sind mir zu düster, als sähe man in Abgründe. In viele Abgründe, in alle Abgründe dieser Welt. Wenn er hier ist, dann malt er, deshalb hat er das große Dachzimmer oben. Außerdem repariert er alle möglichen kaputten Sachen, was sehr praktisch für mich ist, die weder Geduld noch Talent hat etwas wieder ganz zu machen. Mein Talent liegt eher im Zerstören.
Schlau bin ich aus ihm nicht geworden, aber er ist zweifellos ein interessanter Typ. Vielschichtig, wandelbar. Wirkt er an einem Tag introvertiert, fast unhöflich, ist er am nächsten nahezu frech und provokant. Einmal erlebte ich ihn sehr liebevoll mir gegenüber. Das war, als ich mich von meinem Ex trennte, da er mich betrogen hatte, und pausenlos heulte und Wodka trank, den mir Fido hinstellte, ein ums andere Glas. Danach hatte ich die Grippe von der ich vorhin sprach. Und da kochte er mir in einer Tour Tee, nahm mir die Zigaretten ab und erzählte mir von seiner dramatischen Kindheit mit seiner weichen und freundlichen Stimme mit seinem tschechischem Akzent, oder wo auch immer er eigentlich herkommt. Seitdem fühle ich ein Band zwischen uns. Oft denke ich tagelang nicht an ihn. Jetzt wünsche ich mir, dass er hier wäre und der Geruch seiner Zigaretten von oben runterwehte, wenn er am offenen Fenster raucht.
Am Nachmittag gehe ich nach meinem langweiligen, mich unterfordernden Bürojob shoppen. Den Job mache ich nur zum Schein. Einfach, um mich normal zu fühlen und selbst daran glauben zu können. Zumindest ab und zu.
Die Boutique meiner Wahl ist viel zu teuer. Meine Mutter sagte schon als ich 15 war, dass ich einer großen Zukunft entgegen sehen würde, bei meiner Gabe, immer das Teuerste und Exklusivste auszuwählen.
Anscheinend ist es aber noch nicht soweit. Also übe ich mich in Geduld und kaufe vorerst einen stark heruntergesetzten Schal vom Krabbeltisch vor der Tür. Die Alte im Laden sieht mich kühl an. Ich lächle sie überlegen an und sie entscheidet sich doch noch zurückzulächeln. Da sieht man mal wieder, was so ein forsch selbstbewusstes Auftreten macht. Sehe ich gar einen Hauch von Neid in ihren Augen? Ich bin schlank und jung und sie beides nicht. Dass sie die 80-er life und in Farbe erlebt hat, darum beneide ich sie nicht. Ihr Fummel, der aus dieser Zeit zu stammen scheint und sicher teuer war, soll retro wirken, tut es aber nicht. Aber hey, für sein Geburtstjahr kann ja keiner was. Nur für seinen Blick kann jeder was.
Vor meiner Haustür finde ich einen pompösen Blumenstrauß. Ranunkeln, Weißdorn und Misteln und als Hauptattraktion orangefarbene Rosen. Wow!, denke ich und freue mich. Dass ich Blumen liebe scheint mein spießiges Erbe zu sein. Bei einem Blumenstrauß rückt die Zynikerin in mir tatsächlich zur Seite. Insgeheim träume ich von einem Garten voller Blumen.
Ich öffne und schließe die Tür, gehe über die alten, knarzenden Holzbohlen und suche und finde die schöne, alte Vase, die ich vor kurzem auf dem Flohmarkt erstanden habe. Die Blumen passen exakt rein, wie dafür gewachsen und geschnitten. „Wie Arsch auf Eimer“, würde Uschi, meine Nachbarin zur Linken sagen.
Ich betrachte den Strauß in der Vase auf dem großen, alten Holztisch, atme den Duft der Blumen, den Geruch nach nassem Baum, der durchs offene Fenster einströmt und von der alten Platane kommt, ein.
Ein kleines Kuvert steckt im Strauß, doch ich öffne es nicht. Plötzlich ist es mir zuviel.
Kitsch.
Ich lese sie noch immer nicht. Aber ich freue mich darauf.
Vor lauter Aufregung muss ich mir erstmal eine seltene Zigarette genehmigen und klettere umständlich auf die kleine Leiter, um ganz nach oben auf mein Bücherregal zu greifen. Ganz Suchti habe ich mir schwer erreichbare Verstecke angelegt, was an sich schon bescheuert ist. Die größte Lust eine zu rauchen, überkommt mich bei ausreichend reichlichem Alkoholkonsum. Das wiederum schränkt meine Koordinationsfähigkeiten ein. Dass ich allerdings so dicht bin, dass ich mich nicht mehr an die Verstecke erinnere, kommt gar nicht vor. Dass das Ziel der Sucht dann schwer erreichbar ist, ist außerdem eine echte Gefahr. Jakob, der Arzt ist, meinte einmal, dass ich auf jeden Fall umsatzsteigernd bin für ihn in der Unfallchirugie. Er sah mir einmal dabei zu, wie ich die Sprossen rauf mäanderte. Immerhin sprang er auf und hielt sie fest.
Doch jetzt bin ich ja nur aufgeregt. Es ist Morgen und ich klettere elfengleich die Leiter hoch, suche tastend und finde das Päckchen Chesterfields und stelle fest, dass es die letzte ist. Gut eigentlich, denn ich habe ja aufgehört. Nur eben diese eine noch. Ich setze mich und zünde sie mit geschlossenen Augen an. Instantan wird mir schwindlig. Aber ich fühle mich bereit, die Nachricht zu lesen.
Ich würde dich gerne wiedersehen. Ich glaube an den Beginn von etwas ganz Wunderbarem zwischen uns.
Darunter eine Mobilnummer. Oha. Ich blase geräuschvoll den Rauch aus und sehe zu, wie er sich um den Blumenstrauß kräuselt und dann unsichtbar wird.
Ich rufe nicht an. Nachdem ich die Zigarette aufgeraucht hatte, erschien mir die Sache doch zu kitschig. Ehrlich: Blumen und Karte. Der Beginn von etwas Wunderbarem.
„Das es das heute noch gibt … „, ich höre förmlich meine Mutter, sehe ihre erstaunte Begeisterung. Spätestens bei diesem Gedanken bin ich vollkommen nüchtern. Über 100 Jahre Emanzipation und sich dann dennoch über die Oldschool-Reaktionär-Romantika freuen mit den Worten „Das es das noch gibt“.
Mechanisch spule ich mein übliches Programm ab: Laufen an der Alster, Workout an einer der Bänke, wie immer treffe ich am Spielplatz Phillies, der stumpf seine Klimmzüge pumpt.
Den Rest vom Tag dümple ich zwischen Küche und Sofa hin und her. Sehe unkonzentriert TV und lese dabei, was natürlich nicht funktioniert. Die Sache mit dem „Rumhängen“ war mir noch nie zufriedenstellend gelungen. Eine Weile stehe ich an der offenen Balkontür und lasse mich an der kalten Novemberluft durchfrieren. Dabei wird mein Kopf klar. Der Versuch mir sein Gesicht noch mal ins Gedächtnis zu rufen, misslingt und das macht mich stutzig und traurig. Denn eigentlich hat mich die Sache mit dem Blumenstrauß und der Karte doch etwas gefreut.
Weil mir nichts besseres einfällt, beschließe ich in der Pinte ein Bier trinken zu gehen. Ein Tag rundum in der Komfortzone. Vertraut verkommene Gestalten, immergleiche und dennoch unterhaltsame Gespräche. Ein paar flippige Studenten, die die Kneipe legendär finden, wie ich damals auch. Nach zwei Stunden und drei Bier und einen Hugo von Jens, gehe ich heim. Angeschwipst, derangiert und irgendwie deprimiert. Aus dem Schrank hole ich kurzentschlossen die Flasche Scotch, die mein Ex hier hat stehenlassen und gieße mir einen Fingerbreit in ein Glas ein. Schlucke, spüre das Brennen und habe den torfigen Geschmack auf der Zunge. Das Lämpchen am Anrufbeanworter blinkt. Ich zucke mit den Achseln.
Ich habe keine Lust die Nachricht abzuhören. Vielleicht später, doch nicht jetzt. Ich schminke mich ab – im meinem Alter ist es unverzeihlich es zu vergessen – trinke einen halben Liter Wasser in der Küche und falle dann, ohnmachtsgleich in meinem Bett in tiefen Schlaf. Zwei Stunden später wache ich wieder auf. Nüchtern, dafür mit Kopfschmerzen, die ich verdient habe, denn eigentlich wollte ich doch längst mit diesen sinnlosen immergleichen Kneipenbesuchen aufhören. Nach einem weiteren halben Liter Wasser in der Küche wanke ich fröstelnd zum Tisch und drücke mutig auf den Anrufbeantworter.
„Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich wiederzusehen.“ Im Hintergrund die Geräusche einer stark befahrenen Straße zur Rushhour. Fahrradklingeln. „Nach unserem -äh- stürmischen Beginn, also, ich würde dich gerne kennenlernen – also, äh, so wirklich.“
Draußen regnet es heftig, Tropfen schlagen an die Scheibe und ich trete ans Fenster und sehe in die Regennacht raus.
Soweit, so gut, denke ich. Und fühle mich geschmeichelt. Ich sehe ihn in einem hellen Trenchcoat die Kriegsstraße entlanggehen, das Handy am Ohr. Oder war das Inspektor Columbo vor meinem geistigen Auge? Der Versuch, mir sein Gesicht ins Gedächtnis zu rufen, misslingt. Darüber erschrecke ich kräftig und muss dem Drang sofort und unbedingt eine zu rauchen mit Macht widerstehen. Anstrengend! Es ist kurz vor vier und ich beschließe gar nichts, außer noch ein paar Stunden zu schlafen.
Der Wecker klingelt schrill und unbarmherzig zur gewohnten „Es-ist-ein-Arbeitstag-Zeit“. Ich habe Gliederschmerzen und keine Energie. Langsam mache ich mich fertig und absolviere meine stumpfes, semidepressives Job- und Laberprogramm.
„Meda?“
Ich sehe von meinem Artikel hoch. Vor mir steht Lotte und sieht mich an, als stehe sie schon zwei Stunden um Gehör bittend vor mir.
„Mh?“
„Was ich dich fragen wollte — “
Ein typischer Lottesatzbeginn. Ich unterdrücke ein Augenrollen.
„Also wir wollten dich fragen, ob du nachher mit ins Monte kommst.
Oha, denke ich und kann nicht verhehlen, dass mich die Einladung freut. Ehrlich. „Klar“, sage ich nur. Ich schiebe meine Papiere zusammen. „Wann – jetzt?“
„Ten minutes“. Lotte lächelt mich mit ihrem dunkelroten Lippenstiftmund an. Auf ihrem rechten Schneidezahn ist Lippenstift.
„Auf deinem ….“, beginne ich, doch sie hat sich schon umgedreht und steuert ihren Platz an.
Nach meinem langweiligen Hilfsjob setze ich mich manchmal in die Unibib. Schon während meines Studiums saß ich da am liebsten, versank in der betriebsamen Anonymität von Vielen und schrieb dort meine Arbeiten. Ich mag die Atmosphäre. Doch sie erfüllt mich auch mit Wehmut, besonders, wenn ich all die jungen, strebsamen Frauen sehe, die wahrscheinlich nicht als Schreibkraft enden. So fing es nämlich an: Ich bummelte zu lange und musste jobben, war angefixt vom Geld und blieb an einem gewissen Lebensstandard, den ich glaubte, haben zu müssen, hängen. Heute weiß ich es besser, doch der Zug scheint mir abgefahren. Was eine müde Ausrede dafür ist, den Arsch nochmal hochzukriegen.
Um mir diese Option offenzuhalten, zumindest emotional, gehe ich mindestens einmal in der Woche dorthin und recherchiere für meine bislang imaginäre Doktorarbeit. Wenn ich tatsächlich bei einem potentiellen Doktorvater umsehen werde, habe ich immerhin schon einen ziemlich genauen Plan. Das erfüllt mich mit Stolz. Manchmal. Meiner Mutter wäre es sicher lieber, ich sähe mich nach einem potentiellen Familienvater um. Doch sie stammt aus einer anderen Ära und kann nicht mitreden, auch wenn sie das noch nicht begriffen hat.
Vielleicht sollte ich es doch noch einmal versuchen? Weniger Geld, weniger Freizeit, dafür die Aussicht auf einen wirklich guten Job? Dass mich zehn Jahre jüngere Studentinnen ins Monte mitnehmen wollen, gibt mir allerdings schon Auftrieb.
Beschwingt steige ich die Treppe zu meiner Wohnung nach oben. Ich nehme zwei Stufenauf einmal und keuche etwas. Vor der Tür steht in einer großen Vase ein phantastisch bunter Spätsommer -Blumenstrauß.
Die Tür nebenan geht auf und Frau Leutmann steht vor mir. „Ich hab mal die Blumen in eine Vase gestellt – wäre schade um die Pracht“, sagt sie. Ihre Haare schimmern bläulich wohlfrisiert. Der Lippenstift ist in einem Mundwinkel etwas verwischt. „Mann o Mann Meda, Sie haben ja einen Verehrer!“ Sie verschränkt die Arme und zieht ihre akkurat geschminkten Augenbrauen nach oben.
Ich spüre Hitze in meine Wangen steigen.
„Wollen Sie nicht einmal wieder auf einen Kaffee zu mir rüber kommen?“ Ich höre Neugier in ihrer Stimme.
„Gerne, Frau Leutmann, das machen wir die Tage.“
Über ihr Gesicht geht ein Strahlen. Sie ist eine echte Lady der alten Garde. Schon zum Frühstück wie aus dem Ei gepellt. Der Inbegriff von Contenance. Aber eine Seele von Mensch, die schon mal vor Rührung ein Tränchen im Auge hat.
„Ich klingel dann durch, okay? Dann gebe ich Ihnen die Vase zurück.“
„Das eilt nicht.“ Sie lächelt mich an und haucht einen Kuss in meine Richtung, was seltsam schrill aussieht.
Auf dem Tisch prachtet noch der andere Strauß vor sich hin und zeigt keinerlei Ermüdungserscheinungen. Ich betrachte den neuen, den ich in der Vase in der Hand halte. Auch der war ordentlich teuer. Kein Null-acht-fuffzehn Strauß vom Edeka.
Sonnenhut, Hortensie und Sommerflieder, die Namen der anderen Blumen kenne ich nicht.Eine Karte fällt zu Boden, als ich ihn neben den anderen platziere.
Mittwoch Abend im Cello? Bitte sag Ja.
Es kommen noch ein paar Freunde mit, ich hoffe, das ist Dir recht.
Ich stehe vorm Spiegel rum. Das Kleid ist okay und wenn ich mich anstrenge und nicht ständig grimmasiere, dann habe ich ein gutes Gesicht mit kaum sichtbaren Falten. Ich lächle, das zumindest gelingt schlecht.
Das Kleid ist auf Figur geschnitten und endet kurz über den Knien. Für mich eine vorteilhafte Länge, denn meine Knie sind schön und meine Unterschenkel schlank. Über den Bauch ist der Stoff gnädig gerafft, was meinem derzeitigen Zyklusstand entgegen kommt. Meine dunkelroten Stiefeletten passen zum Lippenstift. Zum Fingernägellackieren fehlt mir die Zeit und der Nerv. In über 80 Prozent bin ich sowieso zu ungeduldig und lasse ihn nicht genug trocken, was zu hässlichen Macken führt. Der dunkelbraune Cordblazer entschärft das schlichte, strenge Kleid und harmoniert gut mit den Stiefeletten. Ich fühle mich wohl, beschließe ich. Sei offen und neugierig und versuche nicht zynisch zu sein, Meda, fordere ich mich auf und lächle mein Spiegelbild an. Diesmal gelingt es etwas besser.
Das Cello ist ein gehobenes Restaurant, dabei noch immer leger. Einmal war ich mit meiner Freundin Elsi dort. Im Gegensatz zu ihr fühlte ich mich dort wohl. Sie hingegen lästerte den ganzen Abend über die vermeintlichen Yuppies und Möchtegernreichen.
Beim Eintreten fange ich seinen Blick auf. Sofort springt er auf und kommt mit großen Schritten zu mir. „Meda!“, sagt er entzückt und haucht mir einen Kuss auf die Wange. Entsetzt stelle ich fest, dass mir sein Name entfallen ist. Der Duft seines Aftershaves steigt mir in die Nase, ich spüre, dass meine Wangen heiß werden. Er sieht gut aus mit seiner schwarzen Levis, dem kragenlosen blauen Hemd mit Leinenjackett darüber. Seine Füße stecken in teuer aussehenden Lederschuhen. Mit einer fließenden Bewegung hilft er mir aus der Jacke und hängt sie an die Garderobe, bevor er mich am Ellbogen berührt und neben mir den Tisch ansteuert. Zwei Paare blicken uns erwartungsvoll entgegen. Fluchttrieb droht mich zu übermannen. Tapfer nehme ich dennoch am Tischende Platz. Rechts neben mir sitzt er, dessen Name ich nicht mehr weiß.
Die Frau mit dunkelblondem Pagenkopf zu meiner Linken sagt: „Hallo, ich bin Sabine“ Sie beugt sich dabei etwas zu sehr zu mir und blinzelt. Automatisch blinzele ich zurück und unterdrücke mein „Na und?“ Mein Lächeln sieht wahrscheinlich schrecklich aus. „Ich bin Meda.“
Neben ihr sitzt ihr Mann, das schließe ich daraus, dass sie beide denselben Ring tragen. „Brian“, stellt er sich vor.
Das andere Paar schmeißt die Konversation und redet ohne Unterlass. Beide sind etwas älter, ich schätze sie auf Mitte vierzig. Er trägt einen graumelierten Bart und Brille, sie hat langes, blondiertes Haar und unnatürlich glänzende aufgeworfene Lippen. „Peter und Murielle.“
Ersterer legt sein Gesicht in Falten und Murielle lacht laut, warum, finde ich nicht heraus.
„Freut mich“, sage ich wohlerzogen, denke dabei, na toll, worauf hab ich mich da eingelassen? Und vor allem warum? Der Grund sitzt neben mir und lächelt wie ein Honigkuchenpferd. Noch immer ist mir sein Name nicht eingefallen. Ich verstehe mich selbst nicht mehr und würde am liebsten einen Schnaps bestellen plus eine Aschenbecher, um eine zu rauchen. Doch darauf steht hier Teeren und Federn, wie´s aussieht. Brav und wohlerzogen nehme ich den Vorschlag zum Pinot Grigio an.
Ich werde verhalten herzlich aufgenommen. Mein Kumpel Leander würde sagen: „Diese Leute sind einfach anders sozialisiert.“ Die Unterhaltung startet schleppend. Immer wieder spüre ich die Blicke von Sabine auf mir. Wenn ich aufsehe, sieht sie schnell weg. Sowas habe ich seit meiner Schulzeit nicht mehr erlebt.
Was ich beruflich mache? Oh, wie spannend … als Schreibkraft in einer Anwaltskanzlei, Murielle lacht scheppernd. Augenblicklich vergeht mir die Lust auf diesen Abend. Aber ich lächle tapfer, nicke und stelle mir vor, ich hätte den Mut, auf den Tisch zu steigen und irgendwas Unflätiges von mir zu geben.
„Mit dem Job finanziere ich mir meine Doktorarbeit“, schiebe ich mutig hinterher. Stimmt nicht ganz, war aber rein theoretisch der Plan. Vor einigen Jahren. Die Info tut ihre Wirkung. Ich höre ein „Aha, oh von Peter und kann die Irritation am Tisch förmlich spüren. Und den Keil, den ich gerade zwischen uns geschoben habe. Ich so als Akademikerin. Für einen Augenblick kann ich den Impuls zu lachen kaum unterdrücken. Die Unterhaltung nimmt wieder etwas Fahrt auf. Ich glaube nun eine Veränderung im Verhalten mir gegenüber wahrzunehmen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Nur Peter schließt sich mir an, als ich zum Abschluss nicht nur einen Espresso, sondern auch einen Grappa bestelle. „Gute Idee!“ Er nickt mir anerkennend zu, was ihm einen missgünstigen Blick von Murielle einheimst. Kurz darauf verabschieden wir uns. Ich schüttle höflich Hände und denke, dass ich durchaus noch einen Grappa vertragen könnte.
Er läuft mir hinterher auf dem Weg zu meinem Fahrrad. „Meda? Gehen wir noch ein Stück zusammen?
Oh Mann, bin ich hier in einem Heimatfilm der 50-er gelandet? Mit einem Blick auf die Uhr und auf mein Handy murmle ich etwas von einer Freundin, dich mich noch anrufen wollte.
„Schade, tja dann.“ Er zieht mich zu sich und küsst mich.
Ich winde mich aus der Umarmung. „Du, ich ruf dich an, okay?“ Kurz tut es mir leid und ich drehe mich im Gehen nochmal um und wiederhole nochmal: „Ich ruf Dich an, okay, war schön“, füge ich noch an. Ich schwinge mich auf mein Rad und fahre die zwei Häuserblocks zu Charlies.
Das Charlies ist meine Stammkneipe. Es ist eine Café Bar, wie man sie aus Italien kennt. Tagsüber Café, abends Bar. Charlie ist Italiener, wie man schon am Namen unschwer erkennt. Wir kennen uns seit zehn Jahren, solange lebe ich hier schon im Viertel. In einer langen, denkwürdigen Nacht mit einigen Gin Tonics und ein paar Zwischenbieren stellten wir fest, dass wir einen Tag versetzt Geburtstag haben und versprachen uns feierlich uns fortan zur Seite zu stehen bis wir grau und alt werden und noch darüber hinaus. So ist das mit Charlie.
Er hat mich schon in allen möglichen Stimmungen erlebt, auch in den allermiesesten. Immer aber fühle ich mich zu Hause dort, wenn ich mich sonst nirgends zu Hause fühle.
Bei Charlies ist kaum was los. Die absoluten Nachtschwärmer, die noch um zwei auf einen Absacker kommen sind noch nicht da, die Leute, die morgens früh rausmüssen schon weg. Schmitti, der Dauerstammgast sitzt an seinem gewohnten Platz. Er gehört zum Inventar.
Er nickt mir zu, ich nicke ihm zu und bestelle einen Martini.
„Wie war dein Tag?“ Charlie stellt das Glas vor mich.
„Geht so“, sage ich. „Komisch.“
Er wartet ab, die Hände auf die Theke gestützt, neugierig, ob ich weiter erzähle.
Natürlich tue ich das und das weiß er.
„Ein seltsames Essen mit seltsamen Leuten. Irgendwie gar nicht meins.“ Ich nippe an meinem Martini.
„Die Welt ist voller seltsamer Leute“, mischt sich Schmitti ein, ohne von seinem Glas Bier aufzusehen. Unter seinem speckigen Hut quellen graue Locken, um die ihn die ein oder andere Frau sicher beneidet.
Ich nicke zustimmend, nehme noch einen Schluck.
„Ein Typ?“, fragt Charlie.
„Ja, auch mit einem Typ, waren seine Freunde. Aber naja. Du brauchst gar nicht eifersüchtig zu werden.“ Ich grinse ihn frech an.
Er lächelt.
„Die sind anders sozialisiert. So ganz anders. Von denen ist die Welt voll. Da ist nichts mehr für uns übrig. Die ganzen Yuppies und die ganzen Spießer! Charlie, noch einen Amaro und für die Dame hier gleich mit.“ Er sieht mich an und nickt.
Auch, wenn er oft etwas weggetreten ist, so ist er doch immer sehr höflich und ein durchaus heller Typ.
„Danke“, sage ich artig, trinke den Martini leer und ziehe das Glas Amaro zu mir. Ich proste Schmitti höflich zu und sehe ihm an, dass er gleich einen philosophischen Diskurs beginnen wird. Über Neurreiche, Profitler und Politiker. Meistens in dieser Reihenfolge.
„Kommst du mit vor die Tür eine rauchen?“, rettet mich Charlie.
Ich nicke erleichtert und lächle Schmitti entschuldigend zu. Er macht eine wegwerfende Bewegung und murmelt etwas, während er sich wieder seinem Glas zuwendet und seine Stimme erhebt. „Wenn ich die schon sehe, die Tanten in ihren SUVs mit ihren beigenfarbenen Pudelmützen. Verhungert und bescheuert sehen die aus. Letztens hat mich fast so einer umgefahren, so ein SUV, ich konnte nur den Bommel der bescheuerten Mütze sehen. So eine braucht doch ein Kissen unterm Arsch.“
Ich muss lächeln, doch das kann Schmitti nicht sehen. Die Tür klappt zu und draußen hört man nichts, außer den spätabendlichen Verkehr auf der Bellheimer.
Charlie zündet sich zwei Zigaretten auf einmal an und gibt mir eine. Die Tür fliegt auf und Schmitti läuft eilig an uns vorbei, als hätte er einen Termin vergessen. Wir rauchen schweigend. Plötzlich bin ich traurig.
„Magst du noch einen Tee?“, fragt Charlie.
Auch, wenn mir die Frage erst daneben vorkommt, finde ich die Idee gut und nicke.
Wir sind alleine. Charlie macht mir den Tee und schiebt ihn vor mich, dann räumt er Schmittis Gläser und meine zusammen und guckt mir beim Teetrinken zu.
„Ist heiß“, murmle ich und „Ich geh dann gleich.“
„Kein Stress“, sagt er nur und beginnt die Gläser zu spülen.
Charlie und ich umkreisen uns wie zwei Planeten, die ihre feste Umlaufbahn nicht verlassen. Manchmal sind wir uns nahe, dann wieder weit entfernt. Doch ich weiß immer, dass er da ist. Charlie in seiner Café Bar. Ich nehme einen Schluck von dem noch heißen, aber schon trinkbaren Tee und denke über den Tod nach. Das mache ich öfters. Es kommt einfach so, von alleine. Durch den Alkohol allerdings heftig und ich wische mir verschämt über die Augen. Charlie sieht mich an und in einem anderen Moment hätte ich ihn flapsig gefragt, was er so guckt. Doch der Moment ist anders. Dann ist die Tasse leer. Der Geruch von Rosmarin, Zigarette und Seife, der Charlie immer umgibt, steigt mir in die Nase.
„Na dann, ich geh dann jetzt …“, murmle ich, will aber eigentlich nicht. Er legt seine Hand in meine Armbeuge.
„Bleib.“
Ich verschlafe, wir verabschieden uns hektisch. Ich lasse ihn in meiner Wohnung zurück. Die Sekunden, bis ich ganz wach wurde, waren friedlich und verheißungsvoll. In keinster Weise peinlich. In Ordnung.
Nachdenklich gehe ich die Treppe runter. Schon in der Nacht dachte ich, dass ich nichts Alkoholisches mehr trinken sollte. Zumindest für einige Zeit. Mein Kopf dröhnt. In pinken Leuchtbuchstaben erscheint in meinem Kopf „Kein Alkohol mehr!“ Das mache ich manchmal und glaube so, mein Suchtpotential in Schach zu halten. Mit den Zigaretten ist mir es auf diese Weise weitestgehend gelungen.
Im Büro langweile ich mich über ein paar Akten, die ich anstarre, während ich überlege, ob und was meinem Magen jetzt zuträglich wäre. Gleich wird Sybilla kommen und die Bestellung für das Mittagessen aufnehmen für all die, die das Büro nicht verlassen werden.
Der Typ, für den ich hier im Büro sitze, ist Anwalt, ein hohes Tier in der Branche, wie es scheint. Er ist ein paar Jahre älter, sportlich und anziehend. Aber er lebt in einer völlig anderen Welt, in die die restlichen weiblichen Angestellten Einlass begehren, ich aber nicht. Ich scheine als Einzige keine Angst vor ihm zu haben. Er neigt zuweilen zu archetypisch patriarchalischen Wutanfällen, die die Belegschaft in Schockstarre versetzen, mich aber völlig unberührt lassen, als wäre eine gläserne Trennwand zwischen mir und dem Rest. Gleich im ersten Monat bekam ich solch einen Anfall mit und konnte nur mit den Schultern zucken.
In den darauffolgenden Wochen legte ich es darauf an und rechnete täglich mit der Kündigung. Als Aushilfskraft ist das schnell passiert. Doch das Gegenteil trat ein: Seitdem behandelt mich die stutenbissige Obersekretärin – im Gegensatz zu allen anderen Aushilfskräften – nicht wie Dreck. Kürzlich bat sie mich ein Anliegen wegen irgendeiner Freizeitregelung dem Chef vorzutragen. Da sagte ich ihr, dass sie ihren Scheiß gerne alleine dem cholerischen alten Mann auseinandersetzen konnte. Für 1000 Euro mehr im Monat würde ich mir das aber überlegen. Ihre Gesichtszüge entgleisten für einen Bruchteil einer Sekunde und ich würde noch heute darauf wetten, dass sie sich ein Grinsen verkneifen musste.
An diesem Abend lud sie mich in irgendeine sehr schräge Bar zu einem Feierabendbier ein: ein spießiges, holzverkleidetes Lokal mit dem Ambiente, das zwischen Kleintierzüchtervereinsheim und Sportlerklubhau rangierte und das bestimmt etwas Abseitiges im Keller verbirgt, von dem ich gar nichts wissen will. Noch heute wundere ich mich darüber und sehe sie mit anderen Augen: Diese tipptopp gepflegte mittelalte Frau, die zum Lachen in den Keller geht.
Ich gähne und schlurfe zur Teeküche, in der vor allem Kaffee geholt wird. Der Chef höchstpersönlich steht am Apparat, Hände auf die Arbeitsplatte gestützt und schaut dem Kaffee zu, wie er dampfend und heiß in die Tasse fließt. Ich stocke kurz, richte mich auf, trete neben ihn, um eine Tasse aus dem Schrank zu holen. „Hallo“.
Er fährt hoch und scheint von weither zu kommen. „Ach, Hallo Frau …?“
„Mildenberger“, helfe ich ihm gütig und nicke ihm zu.
Er lächelt freundlich, nimmt seine Tasse, bleibt aber dennoch stehen, als ich meine in die Maschine stelle. Was will er noch?
„Ja bitte?“, frage ich. Ich glaube, es klingt patzig.
Er sieht an. „Frau Mildenberger“, sagt er und mir kommt es vor, als würde er mich auf seine Liste schreiben. Auf was für eine auch immer. „Möchten Sie auch einen Keks?“ In einer leichten Wende, bei der er mich nicht aus den Augen lässt, nimmt er eine kleine Schüssel mit Keksen und hält sie vor mich. Das Rattern der Maschine verstummt, plötzlich hallt die Stille ungewohnt in meinen Ohren. Die Geräusche des Büros sind im Hintergrund gedämpft.
„Ne danke, ich habs am Magen“, sage ich lahm und denke, ich muss hier kündigen. Bald. Sonst würde ich vielleicht meine Feierabende bald in holzgetäfelten Kaschemmen verbringen.
Der Gedanke ist durchgeschlagen. Gekündigt habe ich zwar nicht, aber ich bin in den Bergen. Einfach so. Am nächsten Tag gefahren, ohne jemanden Bescheid zu sagen. Seit Monaten denke ich immer wieder daran. An den Ort, an dem ich meine Ferien als Kind verbrachte. Ich hatte ihn vergessen, er war von meiner Lebensoberfläche verschwunden, nur manchmal, da träumte ich von den Bergen. Den Felsen, den Schneefeldern weit oben und den Geröllfeldern, über die nur ein schmaler Trampelpfad führt und die ich nie alleine gegangen bin. Jetzt werde ich nicht drumherum kommen, ums Alleinegehen.
Ich habe den Geruch vergessen, genau wie ich manche Wörter vergesse, die ich früher oft benutzt habe, dann aber lange nicht mehr ausgesprochen habe, weil sie nicht mehr in meiner Realität vorkamen.
Jetzt stehe ich also vorm Berg, muss hinauf, alleine. Gott sei Dank alleine. Ich bin überwältigt von den Bildern und den Erinnerungen, die plötzlich, nach langer Zeit, mir vor Augen stehen: Mein Vater in seinem karierten Hemd, immer mit einem Stoffhut, damit die beginnende Glatze nicht vebrennt. Piz Buin Lichtschutzfaktor 6 in der braunen Tube, der Geruch, allgegenwärtig, da meine Mutter mich pausenlos damit eincremte. Das braune Paislytuch, das ich als Sonnenschutz dreieckig gefaltet als Kopftuch trug. Die klare, kühle Bergluft, die eigenartig nach Stein riecht. Der Klangteppich aus Kuhglocken und Wassergeplätscher des Bachs, dahinter die grauen, steilen und schweigenden Berge, die mich verstummen lassen.
Das Hotel, in dem ich mit meinen Eltern damals immer abstieg, gibt es zwar noch, war mir aber zu teuer. Also nehme ich vorlieb mit einem kleinen Zimmer in einer Pension für die erste Nacht. Dann mal sehen.
Als ich das Büro verlassen hatte, wusste ich, dass ich nie wieder kommen würde. Das war ein Gedanke und ein Gefühl, das mich anflogen. Ich nahm ihn einfach hin, diesen Gedanken. Ohne mich groß zu scheren. Ging, packte am Abend meine Sachen, trank noch ein Bier bei Charlies und machte alles so, als machte ich es zum letzten Mal. Feierlich, bedächtig.
„Was ist los mit dir, meine Kleine?“ Schmitti entgeht nichts.
„Alles gut.“
„Wer´s glaubt“, sagte er mit einem Achselzucken und trank einen Schluck von seinem Bier. „Ich sehe was, was du nicht siehst“, murmelte er in sein Glas und hatte sich schon wieder abgewendet.
Ich ging, ohne mich zu verabschieden.
Mein Kopf dröhnt vom frühen Aufstehen. Der Rucksack zieht an meinem Rücken. Er ist gefüllt mit belegten Brötchen, Äpfeln und Schokolade. Mit einer Flasche Rivella und einer Flasche Wasser.
Und obwohl ich mir ein sündhaft teures Ticket für alle möglichen Gondeln und Bähnchen gekauft habe: Ich werde ein paar Stunden zu Fuß aufsteigen. Alleine. In den Nebel, der weiter oben ist. Mir ist danach. Mehr als je zuvor.
Außer Frau Miglus, meiner Nachbarin, habe ich niemandem Bescheid gesagt. Sie gießt meine Pflanzen, wenn ich mal weg bin.
„Ganz alleine?“, hatte sie mich gefragte.
„Ganz alleine.“
„Ist das nicht gefährlich, so ganz alleine in den Bergen?“
So ganz alleine werde ich gar nicht sein in diesem Monat. Touristen aus der ganzen Welt tummeln sich dort. Arabische Familien, chinesische Wandergruppen in Topausrüstung. Doch sobald man sich etwas von den Seilbahnstationen entfernt, ist man meistens doch schnell alleine. Um so weiter die Wanderung, um so einsamer. Gut so.
Und wenn man, wie ich jetzt, den Berg von unten, ganz ohne Seilbahn, besteigen will, dann sowieso. Ich begegne niemanden.
Zunächst laufe ich durch Wiesen, sah über Zäune in feinsäuberlich gepflegte Gärten, sehe Traktoren, arbeitende Menschen. Einen Schäfer weiter oben, filmreif mit Mantel und Hut, umgeben von 50 Schafen mit bimmelnden Glöckchen, verstreut auf dem steilen Abhang. Ein bellender Hund, der sie umkreist.
Nachdem ich den letzten Hof hinter mir gelassen habe, wandere ich über Wiesen, durchquere auf schlängelnden Pfaden steile Waldwege. Alles ist hier steil. Die Pflanzen verändern sich. Die Laubbäume bleiben hinter mir, nur noch Tannen und Kiefern, die immer kleiner werden, sich in den Abhang klammern, stehen Spalier.
Auf einer Bank sitzend esse ich einen Apfel und blicke nach unten.
Die Häuser, Autos, die Seilbahnstation, klein wie ein Modell. Der Postbus dröhnt und windet sich die schmale Passstraße empor und eine Stunde später wieder runter. Die Gedanken an zu Hause verlieren an Form. Der Trotz, den ich empfunden habe, löst sich mit jedem weiteren Meter in Schweiß und Keuchen auf. Ich denke nichts und alles zugleich und ich begegne mit Gleichmut all den Gedanken.
Sehr lange bin ich nicht mehr gewandert, damals war ich eine andere. Vergällte pubertierend meinen Eltern jede Wanderung, bis sie mich endlich nicht mehr mitnahmen.
Nach vier Stunden Aufstieg bin ich oben. Nur noch niedrige Büsche säumen den Pfad.
Ansonsten: Fels und Nebel. Meine Beine zittern. Ich habe noch viel mehr Hunger. Es beginnt zu regnen und umsichtig, wie ich bin, habe ich keine Regenjacke eingepackt.
„Das Wetter schlägt um“, warnte mich der Wirt, langsam und bemüht in Hochdeutsch.
„Tja“, sage ich halblaut zu mir. Ich kann nichts weiter tun, als weiterzugehen, um zumindest warm zu bleiben. Nach einer Stunde würde ich an eine Hütte kommen, laut Schild. Bewirtet. Ich sehe auf meine Füße und freue mich, dass ich zumindest gute Wanderschuhe habe.
Als es beginnt zu graupeln und noch dazu Donner durch die Berge hallt, sinkt meine Laune. Ich laufe schneller. Jenseits der Baumgrenze ist schlecht unterstellen und ich bekomme kurz Panik. Was war nochmal zu tun bei Gewitter in den Bergen? Eine Mulde suchen und sich reinlegen? Ich sehe kaum drei Meter weit. Ich gehe weiter, so schnell es eben möglich ist und hangle mich von gelben zu gelben Trapez weiter. Wenn sie bei Sonnenschein auch manchmal albern dicht beieinander angebracht erscheinen, bin ich jetzt richtig froh.
Erleichtert stöhne ich auf, als ich die Hütte vor mir sehe. Aus dem Kamin quillt Rauch. Ich stoße die Tür auf, sofort hüllt mich Wärme ein.
Zwei Männer, einer vor, einer hinter der Theke gucken mich neugierig an. Aus dem Radio dudelt leise Musik.
„Oha“, sagt der, der an der Theke sitzt.
„Perfekt ausgerüstet“, kommentiert der Typ am Zapfhahn und holt in einer fließenden Bewegung ein kleines Glas aus dem Regal an der Wand und füllt es voll mit etwas Dickflüssigem, braunem, das schwer hochprozentig aussieht. Dann füllt er aus einer großen Thermoskanne dampfenden Kaffee in eine große Tasse, kippt den Glasinhalt dazu und schiebt es vor mich. „Zieh erstmal die nasse Jacke aus.“
Ich pelle mich mühsam aus der tropfnassen Jacke und kann das Zittern nicht unterdrücken. Ist mir egal. Die Zähne schlagen aufeinander. Das einzige, was sich halbwegs trocken anfühlt, sind meine Füße. Als ich mich wieder umwende, streckt der andere mir einen zusammengefalteten Pullover aus grober Wolle hin. „Nimm und zieh den an.“ Ich wende mich wieder in die Garderobenecke und ziehe meinen nassen Pulli aus und stülpe den viel zu großen Pullover über. Die kratzige Wolle riecht nach Wald, Holzfeuer, einem Hauch Waschmittel und Zigaretten. Sofort wird mir wärmer.
Dankbar und wortlos beginne ich den heißen Kaffee mit irgendwas stark alkoholischen drin zu schlucken und mir kommt es vor, als hätte ich nie was Besseres getrunken. Meine Kehle brennt. „Danke“, mehr fällt mir momentan nicht ein. Die beiden schauen zufrieden. Der hinter der Theke weist auf die Bank am Ofen im hinteren Teil des schummrigen Raums.
Erschöpft lehne ich mich mit dem Rücken an die warmen Kacheln. Die zwei reden etwas, ich kann nicht verstehen, was. Einen Augenblick nehmen sie Platz am Tisch vor der Bank. Auf einem Tablett steht etwas Brot und Käse, daneben drei Gläser mit eben dieser braunen Flüssigkeit.
Ich nehme die Decke, die der Pullityp mir reicht und lege sie über meine kalten Beine.
„Nett, vielen Dank.“
Der Graupel ist übergegangen in dichte Schneeflocken, es sieht fast aus, als sei alles voller Nebel.
„Ganz schön mutig bei dem Wetter loszuziehen.“
„Oder dumm.“
„Glück gehabt.“
Der eine wendet resigniert die Augen zur Decke. „Städter, Deutsche … ich sag dazu nichts mehr.“ Doch gleich darauf lächelt er mich an. „Ist ja nochmal gutgegangen.“
Ich sage nichts und nicke nur.
Wir würfeln – Zehntausend – ich kenne das Spiel aus meiner Kindheit, unsere Nachbarin spielte es oft mit mir, wenn meine Mutter mit anderem beschäftigt war als mich vom Ballett zum Klavierunterricht, zum Reitunterricht, und zur Mathenachhilfe zu fahren.
Die zwei Männer reden nicht viel und wenn, dann verstehe ich sie kaum, doch das ist mir egal. Sie strahlen eine gelassene Gemütlichkeit aus, die ansteckend ist. Zwischendurch streift mein Blick aus dem Fenster, der Schnee fällt immer dichter. Eine hellgraue Wand.
Jeria, der kräftiger und älter ist als Fritz, bedeckt seine Glatze mit einer Mütze, bevor er aufsteht, die Tür öffnet und einen Schwall kalte Luft mit Schneeflöckchen einlässt. „Mhh, mhh“, brummt er nur und setzt sich wieder an den Tisch. In seinem Vollbart entdecke ich Schneeflocken, die in nullkommanichts schmelzen. Wortlos würfeln wir weiter.
Fritz ist sehnig und schmal. So stelle ich mir einen Marathonläufer vor. Ich gewinne und bekomme einen Enzianschnaps eingeschenkt. „Das ist der Gewinn“, sagt Fritz.
Ich kippe das Glas und spüre augenblicklich mit dem Brennen im Hals, wie er mir zu Kopf steigt. Draußen donnert es. Beide nicken, als hätten sie nichts anderes erwartet.
Im breiten Zungenschlag klärt mich Jeria auf, dass das nun so eine Weile gehen wird und dass ich oben – er deutet mit dem Zeigefinger über sich, ohne mich aus den Augen zu lassen – schlafen muss. An Abstieg nicht zu denken. So ist das eben in den Bergen – höhere Gewalt.
Jeria steht auf und verschwindet hinter der Theke durch eine Tür, um kurze Zeit später mit einem Brett Wurst, Schinken und Brot wiederzukommen. Wir essen und ich merke, wie hungrig ich war und wie wohltuend jeder Bissen ist. Das karierte Flanellhemd von Fritz erinnert mich an das Hemd meines Vaters, das er oft beim Wandern trug. Das Donnern grollt laut und ich zucke zusammen. Jeria zieht die Brauen hoch. „Keine Angst, das hallt so laut im Berg.“ Er hebt die Schultern. „Noch einen Schnaps?“
Ich schüttle den Kopf.
Eine Viertelstunde später gehe ich die schmale Stiege hoch, die ins obere Geschoss führt. Das Holz knarrt, ich spüre die Wanderung und den Alkohol in meinen Beinen. Es fühlt sich seltsam an. Das Flanellhemd dicht vor mir. Ganz hinten im schmalen Flur bleibt Fritz stehen, öffnet eine Tür und sagt: „Bitte, nicht sonderlich groß, aber trocken und warm.“
Sobald ich im Zimmer bin, sagt er „Also dann“, lächelt und geht.
Ich bringe ein „Danke“ hervor und höre ihn die Treppe runtersteigen.
Alles wirkt alt, eng und dabei unglaublich gemütlich. Rot-weiß karierte Leinenvorhänge an den Fenstern. Vor dem Bett ein dicker Wollteppich. Als ich die Wolldecke über dem Bett anhebe, sehe ich, dass es frisch bezogen ist.
Draußen eine Abfolge von Blitzen und Graupelböen, die gegen das Fenster schlagen. Ich ziehe die Vorhänge zu. Mit dem Geräusch, dass das Zuziehen der Vorhänge verursacht, spüre ich Müdigkeit gegen meine Augen drücken. Ich wasche mein Gesicht am kleinen Waschbecken in der Ecke. Entdecke dankbar eine in Papier verpackte Zahnbürste nebst kleiner Zahnpastatube und putze mir die Zähne, bevor ich mich ausziehe, ins Bett falle und mir die Decke bis über die Ohren ziehe. Wie ich mich fühle, kann ich gar nicht herausfinden. Müde wie lange nicht mehr. Ganz lange. Ich denke an einen Augenblick an Charlie und an Fido. Dass ich anrufen sollte. Aber ich vergesse es wieder.
Zwei Stunden später wache ich vom Duft nach Essen auf. Mein Magen knurrt laut. Draußen ist es dunkel. Regen schlägt gegen das Fenster. Mit wackligen Beinen gehe ich die Treppe nach unten. Die Lampe an der kleinen Theke verströmt schummriges Licht. Auf dem Tisch steht ein Teller Suppe und ein Körbchen mit ein paar Scheiben Brot.
Fritz kommt von draußen mit ein paar Scheiten Holz und mit ihm weht kalte, feuchte Luft in die Hütte. „Hat sich eingeregnet“, murmelt er. Er legt das Holz zum Ofen, holt eine Dose Bier aus dem Kühlschrank hinter der Theke und stellt es mir mit einem Glas neben meinen Teller. „Guten Appetit“.
„Danke.“ Haben die beiden schon was gegessen? Es ist halb neun.
„Hab eine trockene Hose hier für dich. Könnte passen.“ Fritz nickt auf die Bank neben mich.
Ich esse heißhungrig. Ist zwar nur eine Tütensuppe, aber sie kommt mir köstlich vor. Der jährliche Campingurlaub mit meinen Eltern steht mir vor Augen. Das erste, was es bei Ankunft gab, war Tütensuppe. Ich habe es geliebt, ab dem Zeitpunkt haben die Ferien für mich angefangen. Mein Vater, der nichts aß, nur eine Dose Bier trank. Meine Mutter, die umherwuselte und auspackte und Sachen geschäftig verteilte. Der Geruch der Luftmatratze, das Rauschen des Meeres ganz nah. Das war, bevor sich ihre Wege trennten und ich mich begann schuldig zu fühlen. Für ihre Trennung, für alles, was dann kam.
Das Brot ist kräftig und frisch. Bevor ich den letzten Bissen geschluckt habe, legt Fritz weitere Scheiben in den Korb und stellt noch einen Teller mit Käse und Schinken dazu. Jeria kommt mit einem Ordner voller Papiere runter und die beiden sind ab dann weitestgehend schweigend damit beschäftigt.
Ich nehme die Jogginghose, stelle mein schmutziges Geschirr zusammen und auf die Theke und sage ein zaghaftes „Gute Nacht“ und „Danke“.
Jeria sagt „Schlaf gut“. Fritz tippt etwas auf dem Taschenrechner und hebt die Hand.
Wellness ist so relativ, denke ich, als ich satt und müde im Bett liege und dem Regen lausche. Das letzte Spa-Wochenende mit Chrissi kommt mir lächerlich schal dagegen vor.
Am nächsten Tag graupelt es zunächst, bevor es in Schnee übergeht. Zweimal will ich aufbrechen, zweimal schütteln die beiden entschieden den Kopf, als ich mein Anliegen verkünde. „Lass es. Du kommst nicht weit. Du musst abwarten. Alles andere ist gefährlich“, sagt Jeria.
Für die beiden spielt es keine Rolle, dass sie hier festsitzen. Gleichmütig tun sie das, was sie zu tun haben: Etwas in der Küche werkeln, Holz hacken, über Papieren sitzen. Fritz ist der Sommerwirt hier. Jeria ein Wanderer, der hier und da bleibt und mit anpackt, wenn es etwas zu tun gibt. „Ich nehm´den Weg, wie er kommt“, sagt er.
Ich hingegen bin unruhig. Was soll ich tun? Hier sitzen und abwarten? Wie lange?
„Der Winter kommt manchmal später, dies Jahr eben früher.“
„Scheint so.“ Fritz steht am Fenster und nickt, während ich unruhig bin und immer nervöser werde. Was soll ich tun? Hier abwarten? Wie lange? Leichte Panik macht sich in mir breit. Was, wenn ich hier für Tage festsitze, für Wochen? Bis zum nächsten Frühjahr.
„Abwarten,“ sagt Fritz und streift mich mit einem Blick. Er hat meine Unruhe bemerkt. „Wird schon nochmal. So ein früher Einbruch, das geht vielleicht eine Woche, dann macht sich´s nochmal auf. Doch jetzt musst warten.“
Eine Woche? Ich denke an die Unterkunft im Tal, an Charlie, an Fido, an meine Wohnung und ans Büro. Ich hab nicht einmal was zum Wechseln dabei. Doch dann zucke ich mit den Schultern. Was soll´s? Ich kann´s nicht ändern. Fritz nickt, als hätte er meine Gedanken gelesen. Vielleicht denkt er aber auch an was ganz anderes.
Spät am Abend, draußen liegt der Schnee kniehoch, klopft es und Fritz fragt durch die Tür, ob ich was zum waschen hätte. Ich knülle mein Shirt, meine verdreckte Hose und meine Unterwäsche zu einem Knäuel zusammen , ziehe mein Sweatshirt wieder über und schlüpfe in die drei Nummern zu große Jogginghose und reiche sie ihm durch die Tür. Unsere Hände berühren sich. „Danke“, sage ich und er sagt auch noch irgendwas, was ich nicht verstehe. Vor einer Woche noch hätte ich nicht gedacht, dass ich mich einmal so über die Existenz einer Waschmaschine freuen würde.